Eine Nachdenkstudie die auch dem ORF anempfohlen werden darf, sofern man dort gelegentlich noch nachdenken will.
Studie. Die Studie stellt für alle, die sich kritisch mit Themen, Trends und Tendenzen des Unterhaltungsfernsehens beschäftigen, eine informative Diskussionsgrundlage dar. Zugleich lassen sich die Ergebnisse der Untersuchung als Aufforderung an die öffentlich rechtlichen Sender verstehen, diese Formate der privaten Anbieter nicht zu adaptieren oder in "sanfter Nachahmung" mit ihnen in den Quotenkampf zu ziehen.
Für Österreich kommt allerdings die Analyse der privaten Quotenprogramme zu spät. Der ORF hat sich mittlerweile auch schlagend in dieser Hohlheit bereits etabliert.
Erstmals werden die Sendungen von Bohlen, Klum und Katzenberger in einer vergleichenden Studie kritisch durchleuchtet, detailliert analysiert und spannend beschrieben. Interviews und Tabellen (Zuschauerzahlen, Quoten, Überblick zu Casting-Shows, ökonomische Daten) runden die Untersuchung ab, die sich auch als Nachschlagewerk nutzen lässt.
Bohlen, Klum und Katzenberger werden als Ikonen einer neuen „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ vorgestellt, die allgemeine Tendenzen des Unterhaltungsfernsehens verkörpern. Während diese Fernsehformate spielerisch Ratschläge für ein erfolgreiches Leben zu geben scheinen, vermitteln sie direkt oder indirekt Normen, Werte und Haltungen, die tief in den Alltag besonders von Jugendlichen wirken. Bohlen, Klum und Katzenberger treffen zielgenau auf die soziale Unsicherheit jugendlicher Zuschauer. Das heimliche Curriculum stimmt nachdenklich: Was zählt, sind Äußerlichkeiten. Selbstvermarktung und Design treten an die Stelle von Substanz, Kompetenz und Qualifikation. Die Dramaturgie der Sendungen wird schonungslos entziffert, die Protagonisten von Casting-Shows und Doku-Soap werden als „Hohle Idole“ kritisiert.
[Rätischer Bote]⇒
Lohnt sich ein Download? Ein schneller Blick auf den Inhalt:
Zusammenfassung 4
1. Bohlen, Klum und Katzenberger – Was gehen sie uns eigentlich an? 7
2. Unterhaltungsfernsehen und gesellschaftlicher Wandel –
Ökonomie und Aufmerksamkeit 12
3. Dieter Bohlen – Clown und Diktator 17
Kurze Geschichte von DSDS 19
Dieter Bohlen – Zur Person 22
DSDS – Ein Tanz von Voyeurismus und Exhibitionismus 27
Immer auf die Schwachen – Häme statt Mitgefühl 33
Die große Illusion – Bohlen ist „ehrlich“ 35
Leistungsprinzip? – Die geforderte Leistung heißt Anpassung 39
Der moderne Zirkus – Diktatur und Plebiszit 43
4. Heidi Klum – „Model-Mama“ mit Befehlsgewalt 46
Heidi Klum – Zur Person 46
GNTM – Der Körper ist mein Kapital 48
Das Gesamtpaket muss stimmen – Gas geben für die „Personality“ 55
Zank und Zickenkrieg – Die Inszenierung 56
Gnade statt Recht – Die Hierarchie 60
Der Kunde ist König – Die Sendung als Werbespot 63
5. Daniela Katzenberger – Von ganz unten nach ganz oben65
Daniela Katzenberger – Zur Person 66
Der „Miezenmacher“ – Bernd Schumacher, TV-Produzent und Manager 68
Natürlich inszeniert – Die Themen 70
Natürlich inszeniert – Die Methoden 79
6. Die Marken – Bohlen, Klum und Katzenberger 87
7. Resümee und Empfehlungen 92
Anhang
Interview mit Dr. Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts
für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) 99
Interview mit Professor Joachim von Gottberg, Geschäftsführer
der freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) 107
Tabellen 111
Literaturverzeichnis 116
Danksagung 122
Hinweise zum Autor 123

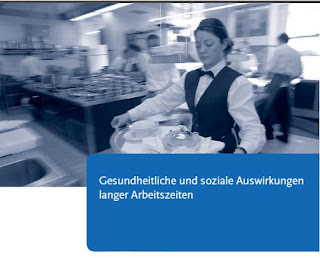



.png)







