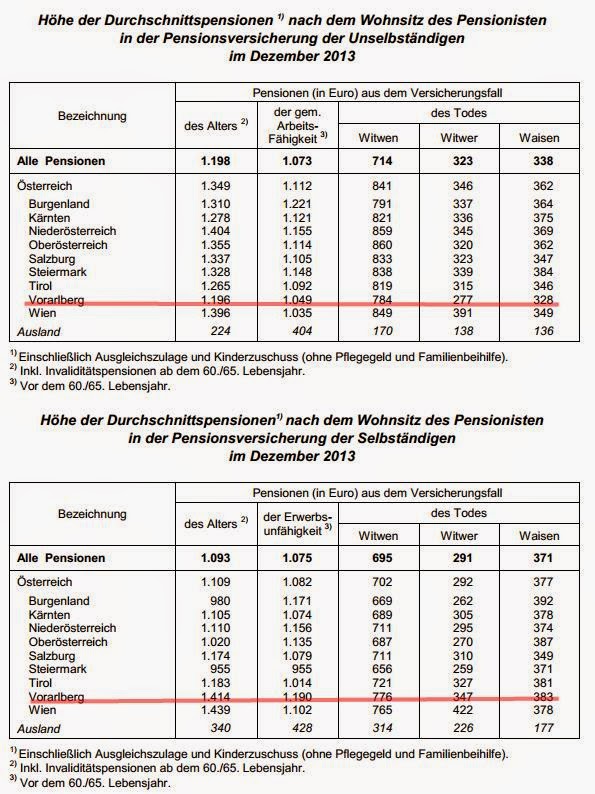Die weltberühmten Salzburger Festspiele werden jedes Jahr von einem Redner festlich eröffnet. 2011 wäre Jean Ziegler eingeladen gewesen. Er war wieder ausgeladen worden.
Ein Vorgang, der nichts Geringeres bedeutet, als in Österreich offenbar alltägliche politische Korruption und parteiliche Einflußnahme zugunsten einiger Konzerne, dies auf Kosten der vom österreichischen Steuerzahler hochsubventionierten Festsspiele, hat man mit österreichischer Gemütlichkeit hingenommen. Der Soziologe Ziegler war jahrelang UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Es gibt wohl kaum jemanden, der den Hunger in der Welt lauter geißelt als Jean Ziegler. Lebensmittelkonzerne wie Nestlé, einer der Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele, wurden von ihm scharf kritisiert.
“Aufstand des Gewissens”, Jean Zieglers geplante Eröffnungsrede, passte nicht ins Konzept. Für Ziegler war es ausgemachte Sache: Nestlé, Credit Suisse u. Co. haben seinen Rausschmiss bewirkt. Siemens ist zusammen mit Credite Suisse, Audi, Nestle und Uniqa einer von fünf Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele. Und einer in der ÖVP wirkt an vorderster Stelle mit: Dr. Christian Konrad. Seit 1990 ist er Obmann der Raiffeisen Holding NÖ-Wien. Weiters ist er Vorsitzender folgender Aufsichtsräte: AGRANA, Kurier, Mediaprint, BIBAG und UNIQUA Versicherungen.
Korruptionsfestspiele. Die selber wegen liederlicher und korrupter Geschäftspraxen in die Kritik geratenen Salzburger Festspiele hatten schon zuvor gegen das österreichische Antikorruptionsgesetz scharf geschossen und im Verein mit dem Raiffeisen-Konrad es zu Fall gebracht. "Wenn nach dem Gesetz jede Einladung kriminell verfolgt wird, wäre das ein schwerer Schlag für das Kultursponsoring", klagt Helga Rabl-Stadler. Rund neun Prozent des Budgets beziehungsweise 4,7 Millionen Euro holt sich die Präsidentin der Salzburger Festspiele von Sponsoren wie Nestle, Siemens oder Uniqa. "Da wird das zarte Pflänzchen Kultursponsoring erdrückt, bevor es aufgeblüht ist. Das wäre das Ende des Sponsorings." (OTS0251 2008-07-03/14:29)
Die undemokratische Politikkultur der Salzburger Festspiele hat eine lange Geschichte.
Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Bertolt Brecht führte in der Kuratoriumssitzung der Salzburger Festspiele am 31. Oktober 1951 zu einem Eklat. Landeshauptmann Klaus, nachmaliger österreichischer Bundeskanzler, beschimpfte den großen österreichischen Komponisten Gottfried von Einem als "Lügner" und "Schande für Österreich".
Gottfried von Einem erinnerte sich später an diese denkwürdige Sitzung: "Da hatte ich endgültig die Nase voll und zu Klaus gesagt, er möge sich doch klarmachen, dass Hitler bereits tot sei und dass sein Ton absolut unverschämt wäre. Daraufhin sprang er, wie von einer Tarantel gestochen auf, warf den Sessel um und schrie: "Entweder verlassen Sie den Raum oder ich!" Worauf ich erwiderte: "Aus Ihrer Gegenwart gehe ich immer gerne fort." Gottfried von Einem berichtet allerdings wohlwollend, dass sich der "Bundeskanzler Dr. Klaus" später dafür entschuldigt habe. Aber dies war nur die eine Seite. Die andere war ein Boykott von Brecht-Stücken an den österreichischen Theatern.
Staatenlos. Brecht verlässt Amerika am Tage nach seinem Verhör durch das Committee for Un-American Activities der McCarthy-Ära. Brecht war am 5. November 1947, von New York kommend, über Paris in die Schweiz eingereist, ohne einen Pass, kaum Geld, keine Bühne, keinen Verlag. Er und seine Frau, die Schauspielerin Helene Weigel, waren staatenlos. Die nationalsozialistische Regierung hatte ihnen im Juni 1935 die deutsche Staatsbürgerschaft "wegen Schädigung der deutschen Belange und Verstoßes gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk" aberkannt. Nach fünfzehnjährigem Exil in mehreren Ländern ließ sich Brecht zunächst einmal in der Schweiz nieder, um von dort die Lage zu sondieren. Er sitzt in Zürich, versucht dort Theater zu machen, eine "Antigone" in Chur, Überlegungen zum "Puntila" in Zürich, Gespräche mit den alten Gefährten: Caspar Neher, Therese Giehse, Ruth Berlau, Oscar Fritz Schuh - und Gottfried von Einem.
Brecht in Zürich. Brecht wäre eigentlich gern noch etwas länger in Zürich geblieben, um von dort aus seine Arbeit in Deutschland zu planen, ähnlich wie es Thomas Mann tat. Aber Rückreisevisa wurden ihm von der Schweiz immer erst nach zähen Bemühungen erteilt. "Aus politisch-polizeilichen Gründen sind wir interessiert, dass Brecht so bald als möglich die Schweiz wieder verlassen muss", ließ die Bundesanwaltschaft die Eidgenössische Polizeiabteilung, welche der Fremdenpolizei vorstand, schon am 24. Mai 1948 wissen und wiederholte dies am 29. März 1949 gegenüber der Fremdenpolizei nochmals direkt: "Nach wie vor sind wir daran interessiert, wenn Brecht die Schweiz so bald als möglich verlassen muss." Der Historiker und sozialdemokratische Parlamentarier Valentin Gitermann, der sich wiederholt für Brecht einsetzte, hielt am 8. April 1949 in einer Eingabe an die Bundesanwaltschaft fest: "Herr Brecht beklagt sich, dass ihm daraus die allergrößten geistigen und materiellen Nachteile erwachsen würden. Er müsste sich dann in Deutschland in der westlichen oder östlichen Zone niederlassen, und dann würden seine Werke in der andern Zone verboten werden. Er lege aber größten Wert darauf, beiden Zonen gegenüber unabhängig zu bleiben. Er wolle, nach wie vor, sich mit seinen Werken im Sinne dieser Unabhängigkeit an das ganze deutsche Volk wenden können. Es widerstrebe ihm überdies, sich um Wiederherstellung seines deutschen Bürgerrechts zu bemühen, solange es keine deutsche Regierung gebe."
Österreichische Staatsbürgerschaft. Der österreichische Komponist Gottfried von Einem, Mitglied des Direktoriums der Salzburger Festspiele, wurde über Vermittlung des Bühnenbildner Caspar Neher aktiv: Er versuchte - Teil seines Plans zur Erneuerung der Festspiele - dem seit 1935 staatenlosen Brecht durch eine Zusammenarbeit mit den Festspielbehörden einen österreichischen Pass zu besorgen. Ohne Papiere konnte Brecht nämlich weder auf Dauer in der Schweiz bleiben noch in eine der deutschen Besatzungszonen einreisen. Einerseits weigerten sich die westlichen Besatzungsbehörden in Österreich und Deutschland, ihm entsprechende Transitpapiere auszustellen, andrerseits gewährten die Schweizer Behörden nur kurzfristige Aufenthalte. Das "anstrengende Geschäft der Exilierten: das Warten", wie Brecht es in einem Brief nannte, und die Bürokratie machten ihm das Leben schwer. Dazu kam erschwerend, dass es zu dieser Zeit noch keine anerkannte deutsche Regierung gab und dass alle Reisedokumente nur als Provisorien angesehen werden konnten. Brecht wurde seine hoffnungslose Lage wieder bewusst, als er im Frühjahr 1949 neuerlich in die Schweiz reiste, um dort Gespräche wegen verschiedener Theaterprojekte zu führen, und die Behörden abermals Schwierigkeiten machten. In dieser Situation hatte Brecht die Idee, sich um einen österreichischen Pass zu bemühen. Gottfried von Einem ebnete Brecht bei den verschiedenen Behörden in Salzburg und Wien den Weg. Im Gutachten des (sozialdemokratischen) Magistrats hieß es beispielsweise: "Die Verleihung der Staatsbürgerschaft wäre ein Gewinn für das kulturelle Leben Österreichs." Die von ÖVP und SPÖ gebildete Landesregierung in Salzburg legte dem Unterrichtsministerium den Akt "zur allfälligen Ausstellung einer Staatsinteressebescheinigung" befürwortend vor und in dem von (ÖVP-) Unterrichtsminister Hurdes unterzeichneten Schreiben hieß es, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Brecht "im Staatsinteresse gelegen" wäre.
"Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen.
Er kommt auch nicht auf so einfache Weise
zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann
überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste
Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass
niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er
gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann
und doch nicht anerkannt wird."
Bertold Brecht (Flüchtlingsgespräche 1948)
Kulturbolschewistische Atombombe. Am 12. April 1950 war es schließlich soweit, und Bertolt Brecht und seine Frau Helene Weigel erhielten die österreichische Staatsbürgerschaft. Als dies jedoch eineinhalb Jahre später in der Blütezeit des Kalten Krieges publik wurde, - tobte der Geist der Reaktion: "Kulturbolschewistische Atombombe auf Österreich abgeworfen" oder "Wer schmuggelte das Kommunistenpferd in das deutsche Rom?". - wollte sich natürlich keine dieser Behörden mehr an ihre Stellungnahmen erinnern. Der Magistrat Salzburg putzte sich damit ab, indem man behauptete, sich "durch die künstlerische Würdigung Bert Brechts im Großen Brockhaus" veranlasst gesehen zu haben, seinem Ansuchen zuzustimmen.
[Rätischer Bote]⇒